Der ehemalige Umweltminister Jürgen Trittin über politische Kämpfe, die Kraft von Zuversicht und warum Konsens ohne Widerspruch nicht möglich ist.
Der gebürtige Bremer Jürgen Trittin ist bekannt dafür, kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Als ehemaliger Bundesumweltminister und langjähriger Vordenker der Grünen hat er politische Transformationen nicht nur gefordert, sondern gestaltet. In seinem neuen Buch mit dem programmatischen Titel „Alles muss anders bleiben“ seziert er den Zustand unserer Gesellschaft – zwischen Klimakrise, Rechtsruck und dem Ringen um politische Mehrheiten.
Im Interview spricht Trittin über Fehler, die Rolle von Emotionen in der politischen Kommunikation und warum Konsens ohne Konflikt nicht möglich ist. Ein Gespräch über Veränderung, Verantwortung und die Frage, ob Zuversicht tatsächlich das stärkste Waffe gegen Hass ist.
Herr Trittin, Sie waren Umweltminister, prägten die deutsche Energiewende maßgeblich mit und sind bis heute eine der profiliertesten Stimmen der Grünen. In Ihrem neuen Buch tragen Sie den provokanten Titel »Alles muss anders bleiben«. Was genau bedeutet dieser Titel?
Im Kern sage ich, dass wir ein anderes Politikangebot brauchen – eines, das sich von dem abhebt, was derzeit sowohl zur Linken wie zur Rechten populär ist. Um Joachim Meyerhoff zu zitieren: »Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war.« Diese Sehnsucht nach einer vermeintlich besseren Vergangenheit ist trügerisch.

Photographien: Michael Jungblut, fotoetage
Wir müssen uns klarmachen: In einer Welt voller Disruptionen und Krisen können wir nur dann eine menschliche und demokratische Gesellschaft bleiben, wenn wir uns den Veränderungen stellen und sie aktiv gestalten. Das ist im Grunde genommen meine Botschaft – eine Veränderungsbotschaft mit einem, wenn man so will, wertkonservativen Grundton.
Weiterlesen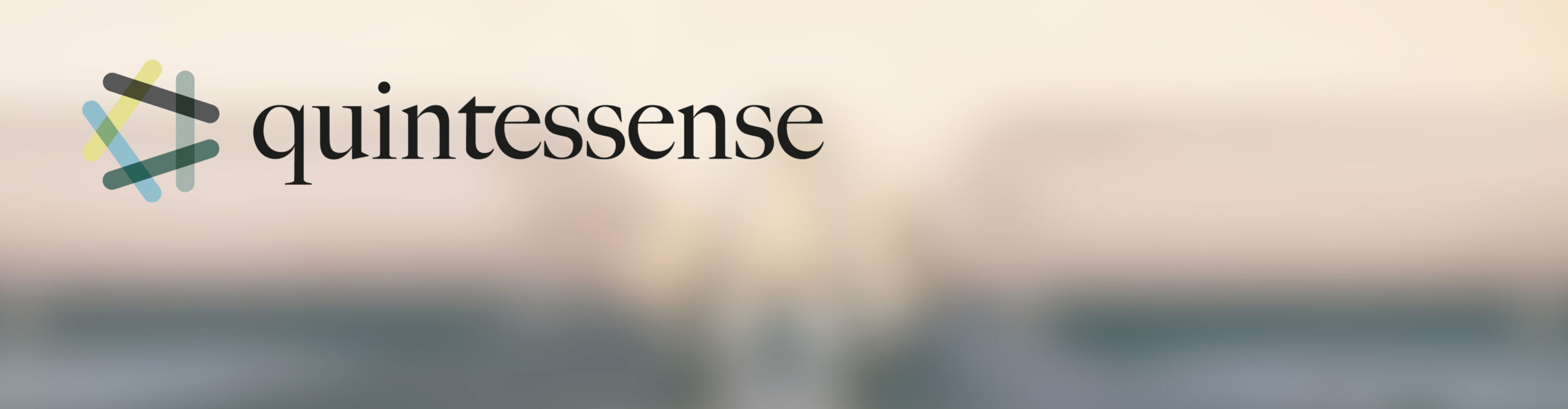











Neueste Kommentare